Der Kriminologe Liviu Alexandrescu hat kürzlich eine Studie über die Medienberichterstattung zu sogenannten „Spice Zombies“ in UK durchgeführt. Insbesondere Menschen, die durch belastende Lebensumstände benachteiligt sind und als Obdachlose im öffentlichen Raum auffallen, sind Objekte abwertender journalistischer Beiträge. Liviu Alexandrescu beleuchtet den Zusammenhang zwischen dieser Form des Journalismus und der Sozial- und Sparpolitik des letzten Jahrzehnts.
Um seine Erkenntnisse auf die Situation in Deutschland zuverlässig anzuwenden, bräuchte es eine eigene Untersuchung; in Anbetracht der jedoch noch geringen kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Medienberichterstattung bezüglich Drogengebrauchs haben wir Liviu Alexandrescu um dieses Interview gebeten.
Während in UK die synthetischen Cannabinoide, genannt „Spice“, zur „Horrordroge“ wurden, drehen sich die Schreckensgeschichten hierzulande meist um Crystal Meth und Heroin. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist dabei ein populärer Schauplatz für abwertende Meinungen über den Drogengebrauch von Armen und Obdachlosen – ohne dass größere (beispielsweise sozialpolitische) Zusammenhänge der Notlagen untersuchen werden (z.B. hier, hier, hier).
#mybrainmychoice: Warum ist die Analyse der Medienberichterstattung über Drogenkonsument:innen ein relevantes Forschungsthema?
Liviu Alexandrescu: Wie wir auch jenseits drogenpolitischer Debatten gut sehen können, wirkt sich die Darstellung verschiedener Ereignisse und Zusammenhänge in öffentlichen Diskursen und deren Entfaltung in den Nachrichten darauf aus, wie schließlich mit sozialen Fragen umgegangen wird. Das ist natürlich aus allen möglichen politischen und philosophischen Gründen von Bedeutung, die mit der Verantwortung einer jeden demokratischen Gesellschaft für ihre schwächsten Mitglieder zusammenhängen. Aber besonders prägnant zeigt sich dies bei Gruppen, die als „problematische Drogenkonsument:innen“ gelten und die in Verbindung mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, rassistischer Polizeiarbeit usw. Benachteiligungen und verschiedenen Formen von Marginalisierungen besonders schutzlos ausgeliefert sind.
Diese Gruppen werden – durch den “Krieg gegen die Drogen” sowie prohibitionistische Drogengesetze von Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Bevölkerung – schon seit langer Zeit stigmatisiert und verschiedenen, teils in sich zusammenwirkenden, Formen symbolischer* und physischer Gewalt ausgesetzt. Kriminologische Forschung sollte daher darauf abzielen, die kulturellen Mechanismen und die anhaltende Stigmatisierung – die den Missbrauch, dem diese Gruppen ausgesetzt sind, oft legitimieren – zu verstehen und ihnen entgegenzuwirken.
In den Mainstream-Medien werden Drogenkonsument:innen im Allgemeinen als obdachlose, kranke, wertlose Menschen dargestellt, die angeblich der Gesellschaft schaden. Es gibt diese Schreckensgeschichten über „Horrordrogen“, wie im Fall der Drogen, die Menschen angeblich in „Spice-Zombies“ verwandeln, die Sie in Ihrem Artikel dekonstruieren. (Inwieweit) sind diese Darstellungen realistisch?
Das hängt davon ab, was man unter „realistisch“ versteht. Sie sind sicherlich übertrieben, wenn man bedenkt, wie verschiedene Wogen der sensationslüsternen Medienberichterstattung über alte und neue Drogen (von LSD und Cannabis bis hin zu MDMA und neuen psychoaktiven Substanzen/NPS) oft die mit ihrem Konsum verbundenen Schäden und die sich um sie herum herausbildenden Jugend(sub)kulturen aufblähen. In einigen Fällen werden wiederum persönliche und soziale Schäden beobachtet, die aus dem Drogenkonsum resultieren. Manchmal ist es schwierig, diese Arten von Schäden analytisch zu trennen und vor dem Hintergrund der Berichterstattung genau zu messen, da es sogar unterschiedliche Interpretationen darüber gibt, was als Schaden anzusehen ist. Aber die Gesamtsituation ist meiner Ansicht nach viel komplexer.
Wenn man in den letzten Jahren durch die Straßen und Stadtzentren lief, konnte man in der Tat viele mittellose Menschen sehen, die unter dem betäubenden Einfluss starker synthetischer Cannabinoide („Spice“) in Hauseingängen zusammenbrachen oder ziellos umherstolperten. Das ist zweifellos kein angenehmer Anblick für die breite Öffentlichkeit und die Sorgen sind durchaus berechtigt. Aber können wir dieses Bild von der systembedingten Grausamkeit der nach der letzten Wirtschaftskrise von der Regierung auferlegten Sparpolitik- und maßnahmen trennen, in deren Folge die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, Wohnraum und andere Sozialleistungen, die wirtschaftlich schlechter Gestellte über Wasser hielten, gekürzt wurden und sich die Obdachlosenquote in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat?
Da stellt sich die Frage, ob erniedrigende Sprachbilder wie „Spice-Zombies“ – die gewissermaßen suggerieren, dass diese Menschen gedankenlose und emotional leere Wesen sind, die ihre Menschlichkeit aufgrund einer Gewohnheit selbstverschuldet verloren haben – von etwas ablenken: Nämlich von den größeren sozialen und materiellen Bedingungen, die dazu beigetragen haben, dass sie sich in diesem Zustand befinden, und von unserer kollektiven Verantwortung, etwas dagegen zu unternehmen. Ich denke, dass solch eine negative Sprache, die ihre Persönlichkeit verleugnet und sie als selbstschädigende „Andere“** darstellt – umso mehr, wenn sie von den Massenmedien gestützt wird – sie auch zu leichten Zielen für den Zorn der Öffentlichkeit machen kann. Damit werden schließlich jene kritischeren Gespräche in den Schatten gestellt, die wir führen müssen, um die sehr toxischen Auswirkungen der enormen Ungleichheiten und struktureller Benachteiligungen in Frage zu stellen, die sich im Zusammenhang mit Drogen oft noch verschlimmern.
Gemäß Ihrem Artikel tragen Journalist:innen entscheidend dazu bei, die Annahme von Unterschieden zwischen „verdienstvollen Subjekten der gesitteten Gesellschaft und den unteren, sozialstaatsabhängigen Schichten“ zu fördern. Welche politische Ansichten stehen hinter dieser Vorstellung und wie hat sie die allgemeine Wahrnehmung des Drogenkonsums und von Drogenkonsument:innen beeinflusst? Warum wird in der Berichterstattung Drogenkonsum meist mit Kriminalität und Versagen in Verbindung gebracht?
Journalist:innen, und das weiß ich aus meiner eigenen Berufserfahrung, die ich in so einigen Jahren in der Medienbranche gesammelt habe, gestalten ihren Arbeit oft so, dass sie der kommerziellen Logik der Medienunternehmen folgt, von denen sie ihr Gehalt bekommen. Eine gute Geschichte ist eine Geschichte, die die Aufmerksamkeit der Leute erregt und die einfach verständlich ist. Das Narrativ vom „Krieg gegen die Drogen“ ist seit mehr als einem Jahrhundert eine kommerziell ziemlich erfolgreiche Erzählung, eben weil sie so einfach ist: Psychoaktive Drogen sind von Natur aus kriminell und zerstörerisch, die Polizei muss streng gegen sie vorgehen, und dann werden alle Probleme, die sie mit sich bringen, verschwinden. Das war aber nie der Fall und der Krieg wurde nie gewonnen. Stattdessen hat sich daraus ein übertrieben vereinfachtes Narrativ verfestigt, das besagt, dass mit Disziplinarmaßnahmen und entsprechenden Strafen reagiert werden soll, wenn illegalisierte Substanzen schlecht vertragen werden – insbesondere wenn dies öffentlich sichtbar ist.
Demgegenüber haben sich in jüngster Zeit viele Drogen in den Jugend- und Clubkulturen des Westens und darüber hinaus – in Bezug auf Konsum, Verfügbarkeit, kultureller Akzeptanz – normalisiert und teilweise gab es sogar gewisse gesetzliche Reformen. Was die Abhängigkeit betrifft, haben sich inzwischen jedoch einige andere beunruhigende Vorbehalte im öffentlichen Bewusstsein entwickelt – unabhängig vom Drogenthema. Einer davon ist die Abhängigkeit von staatlicher und sozialer Hilfe, und hier gibt es einen langen historischen Verlauf in der konservativen politischen Themenwahrnehmung, dass der Mangel an persönlicher Freiheit, Autonomie und Unternehmergeist Charakterfehler seien, die durch Sozialhilfeleistungen und Großzügigkeit nur noch verschlimmert werden. Wenn man den Bedürftigen zu viel „unverdiente“ Hilfe zustehe, ermutige man sie zusätzlich, weiter in Faulheit und Elend zu verharren. Hier wirkt diese moralische Unterscheidung zwischen „gesittet und bedürftig“ auch symbolisch am stärksten und schafft sowas wie ein zweifaches Stigma – Substanzabhängigkeit trifft auf extreme Armut und wird als Zeichen moralischer Schwäche und Erbärmlichkeit der Unterschicht abgetan. Eine Person oder sichtbare Gruppe, die sowohl arm als auch drogenabhängig ist, könne nur moralisch schwach und abhängig sein, sowohl in Bezug auf die Substanz, auf die sie fixiert sei, als auch in Bezug auf die Wohltätigkeit anderer. Dies ist eine dieser schlichten Erzählungen, die die Komplexität des menschlichen Lebens verschleiert und uns blind macht für das Leiden derer, die wir kollektiv als unumkehrbar verloren abschreiben.
Während oft argumentiert wird, dass Obdachlose, die Drogen konsumieren, für die Gesellschaft kostspielig seien, weisen Sie stattdessen auf die „sozialen Kosten“ hin. Was meinen Sie damit?
Dies geht auf jene symbolische, klassenbezogene Unterscheidung zurück, wer die drogenkonsumierenden Menschen sind, die wir als des Mitgefühls würdig erachten. Drogen, die für junge Menschen aus der Mittelschicht besonders interessant sind (MDMA, Mephedron usw.), lösen andere Ängste aus als jene, die mit Menschen in schlechteren Lebensumständen assoziiert werden (Heroin, Crack usw.). Die Angst vor Drogen, die sich um erstere Personen dreht, wird in der Regel mit den Begriffen „Risiko“ und „Unschuld“ geframed: naive, aber moralisch wertvolle junge Menschen, die durch den Konsum schlechter Drogen ihre Zukunft bedrohen oder möglicherweise stören, und die von der Gesellschaft (und den Strafverfolgungsbehörden) geschützt werden müssen. Wenn wir die andere Art Angst vor Drogen betrachten, die sich eher auf benachteiligte Konsument:innen aus marginalisierten sozialen Schichten konzentriert, dann geht es eher um die Menschen selbst, die die Drogen konsumieren, als eine Quelle von Kriminalität und Seuche, die es einzudämmen gelte. Sie werden als unbrauchbar und entsorgbar wahrgenommen, vor allem in Krisen- und Mangelsituationen.
Das haben wir an den Medienbildern der letzten Jahre von Obdachlosen auf synthetischen Cannabinoiden als eine weitere Quelle von Angst im städtischen Raum erkennen können. Und implizit im Unterton jener Art Berichterstattung, die besagt, dass etwas dagegen getan, und zwar dass der öffentliche Raum von ihrer Anwesenheit gesäubert werden sollte. Aber die sozialen Kosten, auf die ich mich beziehe, sind eben jene, die diese Lebensumstände hervorbringen, und es als unangenehm empfinden lassen, diese öffentlich mitansehen zu müssen. Das heißt jene Kosten, die der gesamten Gesellschaft, vor allem aber den wirtschaftlich Schwächsten entstehen, die sich aus politisch-ideologischen Entscheidungen wie staatlich verordneten Haushaltskürzungen und Sozialabbau ergeben. Beispielsweise liegen heute sieben der zehn ärmsten Regionen Nordwesteuropas in Großbritannien, wobei 4,1 Millionen Kinder in Armut leben, 500.000 mehr als vor 5 Jahren – eine Zeit, in der sich auch die Nutzung der Tafeln fast verdoppelt hat und die den UN-Sonderberichterstatter zu extremer Armut dazu veranlasst hat, die Sparmaßnahmen als „soziale Katastrophe“ zu bezeichnen. In diesem Sinne spiegelt die Anwesenheit sogenannter „Spice-Zombies“, die in den Stadtzentren herumlungern, so unangenehm das auch sein mag, diese großen einschneidenden sozialen Veränderungen und das Elend, das sie hervorbringen und das sich im Hintergrund allmählich entfaltet.
Was ist dabei die Verantwortung der drogenpolitischen Gestaltung und ihr Einfluss auf eine Verbesserung der Situation? Wie kann Drogenpolitik dazu beitragen, die Stigmatisierung zu verringern?
Dies sind sicherlich Probleme, die sich über den Bereich der Drogenpolitik hinaus erstrecken. Die Drogenpolitik hat natürlich auch Auswirkungen – in UK wurden neue psychoaktive Substanzen (NPS) wie synthetische Cannabinoidrezeptor-Agonisten (SCRAs, oder kurz „synthetische Cannabinoide“/„Spice“) durch das Gesetz über psychoaktive Substanzen von 2016 auf die Straßenmärkte gedrängt, das jüngste Werk der prohibitionistischen Totalverbots-Gesetzgebung, das alle NPS kriminalisierte und die Head Shops, die sie zuvor verkauft hatten, schließen ließ. Auf diese Weise wurden sie an weniger gewissenhafte Dealer weitergegeben, die schließlich Obdachlose ins Visier nahmen und sie teils auch mit anderen Drogen versorgten, die das Risiko- und Schadenspotenzial verstärkten. Dies wurde selbst von der britischen Regierung in einer späteren Bewertung dieser Gesetzgebung erkannt. Weltweit zeigen die Erfahrungen deutlich, dass die Prohibition häufig die unerwünschte Folge hat, neue Marktzyklen zu fördern, in denen eine Reihe verbotener Substanzen durch eine andere, wirksamere, jedoch unbekanntere und potenziell gefährlichere Auswahl ersetzt wird. Daher wäre es vielleicht ein sinnvoller Ansatz, anders darüber nachzudenken, wie wir die Angebotsseite kontrollieren, um Risiken und Schäden zu reduzieren.
Das Problem ist jedoch viel umfassender und betrifft die Sozialpolitik generell. Drogen vom Typ „Spice“ sind auch in die (oft überbelegten, unterbesetzten und unterfinanzierten) britischen Gefängnisse gelangt, wo Selbstschädigung, Suizid und Gewalt ebenfalls zugenommen haben. Es gibt aber auch ein kulturelles Problem im Zusammenhang mit dem Stigma, das von ihnen ausgeht. Wir haben gesehen, wie Websites und Social Media-Seiten eingerichtet wurden, um demütigende Bilder und Filmaufnahmen von Obdachlosen, die von „Spice“ berauscht sind, zu sammeln und zeigen, und auf denen einige Online-Besucher:innen hasserfüllte Kommentare hinterlassen oder offen zu Gewalt gegen sie aufgerufen haben. Dies ging so weit, dass ein englischer Gemeinderat in Sheffield eine eigene Social Media-Kampagne aufgestellt hat, um dem Trend entgegenzuwirken und dazu aufzufordern, keine Menschen in der Öffentlichkeit zu filmen oder zu fotografieren, die die betäubende Wirkung synthetischer Cannabinoide erleben. All dies bedeutet, dass wir über Drogen und Rausch an sich hinausschauen sollten, um jene größeren Fragen zu stellen, die sich damit beschäftigen, wie wir gerechtere, solidarischere Gesellschaften aufbauen können, in denen sich jenen angenommen wird, denen am wenigsten Glück vergönnt ist.
Welche Lehren sollten Journalist:innen aus der Berichterstattung über Drogenkonsum und Drogenkonsument:innen ziehen?
Es gibt zunehmend stimmige Berichterstattung, die auch die größere Perspektive berücksichtigt und einige Publikationen werden neue Konventionen und Methoden anwenden, mit denen sie dies stärker vermitteln können. Es gab auch zahlreiche Aufrufe von Aktivist:innen und Befürworter:innen drogenpolitischer Reformen, damit zu beginnen, die im Zusammenhang mit Drogen und Sucht verwendete Sprache zu ändern und zu einer nuancierteren und kontextualisierteren Berichterstattung über diese Themen überzugehen. Einer der jüngsten Beiträge zu dieser Debatte kam von der Global Commission on Drug Policy (in der sich Personen aus der Politik, den Medien, der Geschäftswelt usw. global organisieren). Darin wurde nahegelegt, dass ein einfühlsameres Vokabular wie „Personen, die Drogen nehmen/konsumieren“ statt „Drogenkonsumierende“ oder „Person mit einer Abhängigkeit“ statt „Abhängiger“, „Süchtiger“ oder „Junkie“ das Gespräch von alten Stereotypen wegbringen kann, und zwar umso mehr, wenn es mit einer stärkeren Konzentration auf Prävention und Aufklärung einhergeht. Ein ausgewogener Journalismus und das Einbringen von Gegenargumenten sowie die Einbeziehung der Stimmen von Menschen, die selbst Drogen konsumieren, gehören zu den von weiteren Organisationen wie AOD Media Watch oder der britischen Drug Policy Commission empfohlenen Leitlinien für die Berichterstattung. Aber auch hier bezweifle ich wieder, dass eine Änderung der Wortwahl ohne konkrete Änderungen in der Sozialpolitik und der materiellen Umstände jener Menschen, die den Schäden, die aus Drogenkonsum resultieren können, am meisten ausgesetzt sind, einen maßgeblichen Unterschied machen kann.
Sie beenden den Artikel mit einem Appell an die kritischen Wissenschaften, stigmatisierende Politik aufzudecken und populäre Mythen in Frage zu stellen. Können Sie den Student:innen und Forscher:innen, die dieses Interview lesen, einige Ihrer Lieblingsthemen empfehlen?
Gerne, im Blog der Oxford Brookes University Library finden Sie einige Buchempfehlungen, die ich zu den größeren Fragen rund um Drogen und Drogenpolitik besonders aufschlussreich fand.
Im Hinblick auf die Herausforderungen, die die jüngsten Entwicklungen auf den globalen Drogenmärkten mit sich bringen, gibt es zwei Sonderausgaben, die vom International Journal of Drug Policy und Drugs: Education, Prevention and Policy herausgegeben wurden (leider nicht kostenlos verfügbar), die verschiedene internationale Perspektiven darüber zusammenbringen, was bisher passiert ist und was zukünftig möglich ist.
Woran arbeiten Sie aktuell?
Ich habe ein wachsendes Interesse an der Kulturkriminalistik. Dieser Wissenschaftsbereich stellt die populären Darstellungen von Kriminalität und Fehlverhalten (deviance***) in den Nachrichten, im Film und in anderen Medien weitgehend in Frage. In diesem Zusammenhang beschäftige ich mich derzeit mit der Bedeutung und den Darstellungen von Gewalt in dystopischen Kriminalfilmen wie The Purge.
Vielen Dank für das Interview, Liviu Alexandrescu!
*
Über Symbolic violence bzw. Symbolische Gewalt – Zurück zur Textstelle
**
Über Othering – Zurück zur Textstelle
***
Über Deviance bzw. Devianz oder auch „Abweichendes Verhalten“ – Zurück zur Textstelle
Die Erläuterungen zu den akademischen Begriffen wurden von #mybrainmychoice zusammengestellt.
Über den Autor:
Liviu Alexandrescu ist Dozent für Kriminologie an der Oxford Brookes University. Vor seiner akademischen Laufbahn war er als Journalist für Fernsehsender und in den Printmedien tätig.
Das Interview bezieht sich auf die Studie “Streets of the ‘spice zombies’: Dependence and poverty stigma in times of austerity” von 2020, erschienen im Crime, Media, Culture: An International Journal.

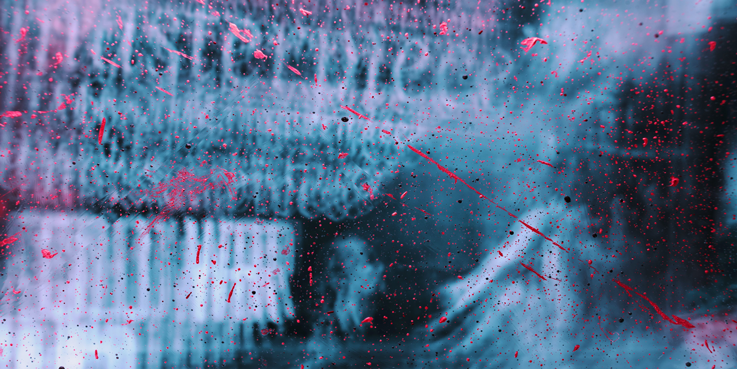
Kommentare sind geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind möglich.