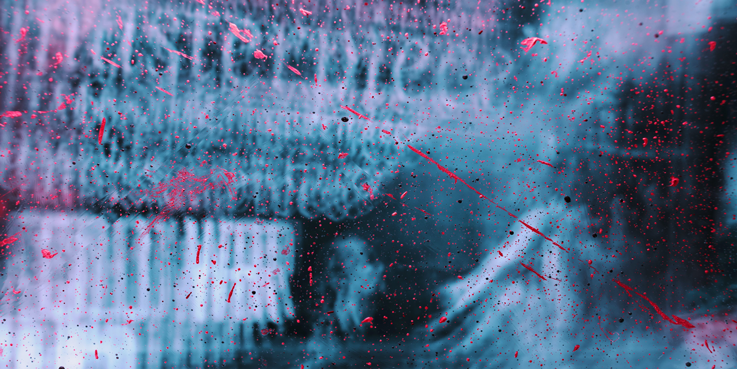Der diesjährige Berliner Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende stand unter dem Motto „Öffentlicher Raum für alle. Safe Spaces – Safer Use.“ Statemens von Mitarbeiter*innen der Drogenhilfe sowie von Betroffenen Menschen wurden von O‑Tönen der Menschen begleitet, die täglich mit Obachlosigkeit, Kriminalisierung und Illegalität konfrontiert sind. Am Oranienplatz wurde das neue Denkmal, die bunte Bank, enthüllt. #DuFehlst Auf dieser Seite: Fotodokumentation Stellungnahmen…
Kategorie: Ent-/Stigmatisierung
Sicherheit statt Mitleid – 271 Drogentodesfälle 2023 in Berlin. Ein trauriger Höchststand.
Pressemitteilung: Aktionsbündnis gedenkt am 22. Juli verstorbenen Drogengebraucher*innen in Berlin Noch nie gab es in Deutschland (2227) und in Berlin (271) eine solch hohe Zahl von Menschen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch illegalisierter Substanzen verstarben. Am Montag, den 22.07. gedenkt das Berliner Aktionsbündnis am Kottbusser Tor und auf dem Oranienplatz den verstorbenen Freund*innen, Angehörigen, Klient*innen, Mitmenschen. „Der Gedenk- und…
2016/2017 hat eine Gruppe aus Fachleuten der Suchtforschung und anderen Disziplinen sowie Praktiker*innen der Suchthilfe ein Memorandum erarbeitet. Es schildert die Problematiken der Stigmatisierung von Sucht und gibt Kolleg*innen sowie der Politik Handlungsempfehlungen, um diese zu beheben. Die Autor*innen des Memorandums werden am Ende der Seite vorgestellt. Die #mybrainmychoice Initiative war nicht an der Entstehung des Memorandums beteiligt. Wir verwenden…
Niemand ist uncool.
Der Redebeitrag von Philine Edbauer zur Hanfparade 2021 Cannabis wird seit 12.000 Jahren von Menschen kultiviert. Das globale Cannabis-Verbot ist vor diesem Hintergrund undenkbar absurd. Es richtet seit 50 Jahren Schaden an, in Deutschland in Form des Betäubungsmittelgesetzes. Sowohl durch Geldstrafen, Führerscheinentzug, Haft, Arbeitsplatzverlust, Ausgrenzung, Polizeigewalt und lächerliche Präventionsarbeit, die Kindern eine Welt vorlügt, die es nicht gibt. Als auch…
Jörg Böckem, geb. 1966, arbeitet als freier Journalist für renommierte Zeitungen wie den Spiegel, Die Zeit und das ZEIT-Magazin. Er hat drei Bücher über Drogen, Rausch und Sucht geschrieben und ist Co-Autor zweier weiterer Bücher, unter anderem des Aufklärungsbuchs „High sein“ (2015), das er zusammen mit dem Substanzforscher und Präventions-Praktiker Dr. Henrik Jungaberle geschrieben hat. In seiner Autobiographie „Lass mich…
Der Kriminologe Liviu Alexandrescu hat kürzlich eine Studie über die Medienberichterstattung zu sogenannten „Spice Zombies“ in UK durchgeführt. Insbesondere Menschen, die durch belastende Lebensumstände benachteiligt sind und als Obdachlose im öffentlichen Raum auffallen, sind Objekte abwertender journalistischer Beiträge. Liviu Alexandrescu beleuchtet den Zusammenhang zwischen dieser Form des Journalismus und der Sozial- und Sparpolitik des letzten Jahrzehnts.
Um seine Erkenntnisse auf die Situation in Deutschland zuverlässig anzuwenden, bräuchte es eine eigene Untersuchung; in Anbetracht der jedoch noch geringen kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Medienberichterstattung bezüglich Drogengebrauchs haben wir Liviu Alexandrescu um dieses Interview gebeten.
Während in UK die synthetischen Cannabinoide, genannt „Spice“, zur „Horrordroge“ wurden, drehen sich die Schreckensgeschichten hierzulande meist um Crystal Meth und Heroin. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist dabei ein populärer Schauplatz für abwertende Meinungen über den Drogengebrauch von Armen und Obdachlosen – ohne dass größere (beispielsweise sozialpolitische) Zusammenhänge der Notlagen untersuchen werden (z.B. hier, hier, hier).
How we talk about drugs and why it matters
#mybrainmychoice: Why is the analysis of media coverage on drug users a relevant research topic?
Liviu Alexandrescu: As we can see well and beyond the scope of drug policy, how public discourse frames various events and conditions unfolding in the news cycle has consequences in terms of how the social issues framing them are eventually dealt with. This obviously matters for all manner of political and philosophical reasons relating to any democratic society’s responsibility to look after its most vulnerable. But even more so when it comes down to groups such as those deemed to be ‘problematic substance users’, who tend to be exposed to other vulnerabilities and forms of marginalization pertaining to low socio-economic status, racist policing and so on.
These have been groups historically stigmatized and subjected to various forms of symbolic* and physical violence under the guise of the ‘war on drugs’ and prohibitionist drug laws, by governments, law enforcement and civil populations, often in complicity. Criminological research should aim to understand, as well as counteract the cultural mechanisms and persisting stigma that oftentimes legitimise the abuse they face.